 | |||
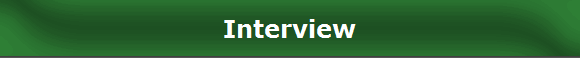 | |||||
Die Navigation auf dieser Website funktioniert am besten mit aktiviertem Java-Script | |||||
Interview mit Marcel-Paul Schützenberger
Marcel-Paul Schützenberger: Die Wunder des Darwinismus Einführung Bis zu seinem Tod war der Mathematiker und Doktor der Medizin Marcel-Paul Schützenberger (1920 – 1996) Professor der Fakultät der Wissenschaften an der Universität von Paris und ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Im Jahre 1966 nahm Schützenberger am Wistar Symposium teil mit Vorträgen und Arbeiten über mathematische Einwände gegen den Neo-Darwinismus. Seine Argumente waren subtil und wurden von den Biologen oft mißverstanden. Er bemerkte, daß Darwins Theorie und die Interpretation biologischer Systeme als formale Objekte strittig waren insofern, da allgemein bekannt ist, daß der Zufall die Absicht und das Ziel in formalen Kontexten herabsetzt – also Ordnung zerstört und eine Zunahme der Entropie bewirkt. Schützenberger brachte des weitern vor, daß Darwins Theorie logischerweise einige aktive Koordinationsprinzipien zwischen dem typographischen Raum der informatorischen Makromoleküle (DNS und RNA) und dem organischen Raum lebender Kreaturen selber benötigt – welche Darwins Theorie nicht zur Verfügung stellt. Im folgenden Interview, das die französische wissenschaftliche Monatszeitschrift La Recherche mit ihm machte, (hier übrigens zum erstenmal auf Deutsch vorliegend) verfolgte er diese Themen erneut, inspiriert von seinen eigenen Forschungen auf den Gebieten der Mathematik und Kybernetik (Computerforschung) und in der Tradition der Forschung französischer Biologen von Georges Cuvier bis hin zu Lucien Cuenot. M. P. Schützenberger war ein Mann von universaler Neugier und großer geistiger Fähigkeiten; sein Leben lang war er stets freudig und unerschrocken. Die Denkkultur, deren brillanter Repräsentant er war, entschwindet mit ihm. Sie war seine beste Frucht und nun gehört sie, leider, zum Inventar der erinnerten Dinge. F: Was ist Ihre Definition des Darwinismus? S: Die aktuellste, natürlich, eine Position, die allgemein verkörpert wird, zum Beispiel von Richard Dawkins. Die wesentliche Idee ist wohl bekannt. Evolution, argumentieren Darwinisten, wird erklärt durch das doppelte Wirken von Zufallsmutationen und natürlicher Auslese. Die allgemeine Doktrin wird durch zwei sich widersprechende Schulen verkörpert – Gradualisten auf der einen und Saltationisten auf der anderen Seite.. Gradualisten bestehen darauf, daß Evolution mittel kleiner sukzessiver Änderungen fortschreitet; Saltationisten, daß sie durch Sprünge fortschreitet. Richard Dawkins ist dahin gekommen, radikalen Gradualismus zu verfechten; Stephen Jay Gould, eine nicht weniger radikale Version des Saltationismus. F: Sie sind eher als Mathematiker bekannt denn als Spezialist für evolutionäre Biologie.. S: Biologie ist natürlich nicht mein Spezialgebiet. Die Teilnahme von Mathematikern an der allumfassenden Beurteilung evolutionistischen Denkens ist ja von den Biologen selbst ermutigt worden, wenn auch nur deswegen, weil sie ein so unwiderstehliches Ziel darstellten. Richard Dawkins zum Beispiel ist in fataler Weise von Argumenten angezogen worden, die so erscheinen würden, als hingen sie von Konzepten ab, die der Mathematik und den Computerwissenschaften entnommen wären und hat deren technischen Kram mit all seiner komischen Autorität auf unschuldige Leser losgelassen. Mathematiker sind in jedem Fall erkenntnistheoretische Eiferer. Für sie ist es ganz normal, ihre kritischen Bedenken zu den Fundamenten anderer Wissenszweige zu bringen. Und schließlich, es ist wert festzustellen, daß die riesige Welle der Kybernetik Mathematiker von ihrem normalen mittelozeanischen Aufenthaltsort an die fernen Küsten evolutionistischer Biologie getragen hat. Da kann man Rene Thom und Ilya Prigogine beobachten, wie sie ruhig trockenem Land zupaddeln und dabei Mitglieder des Santa Fé Instituts bei ihrer Totenwache verprügeln. Stuart Kauffman ist unter ihnen. Ein interessanter Fall, ein Mediziner, halb verliebt in mathematische Logik, nun und für alle Zeiten beladen mit dem päpstlichen Kuß, den er von Murray Gell-Mann bekommen hat. Diese ökumenische Bewegung bemühte sich, die Konzepte der Mathematik auf die fundamentalen Probleme der Evolution anzuwenden – die Interpretation funktionaler Komplexität zum Beispiel. F: Was meinen Sie mit funktionaler Komplexität? S: Es ist unmöglich, das Phänomen des Lebens ohne dies Konzept zu begreifen, die zwei Wörter beschreiben eine elementare und unerläßliche Idee. Die normale und ungezwungene Mundart eines Labor-Biologen ist fast immer in funktionale Begriffe verpackt: die Funktion eines Auges, die Funktion eines Enzyms oder eines Ribosoms, oder die Fühler der Fruchtfliege – ihre Funktion; das Konzept, durch das solche Sprache angeregt wird, ist eines, das perfekt an die Realität angepaßt ist. Physiologen sehen dies besser als irgend jemand anderer. Innerhalb ihrer Welt ist alles und jedes eine Angelegenheit von Funktionen, die mannigfaltigen Systeme, die sie studieren – Kreislauf-, Verdauungs- und Ausscheidungssysteme und ähnliches – werden alle in einfachen, ineliminablen funktionalen Fachausdrücken beschrieben. Auf der Ebene der Molekularbiologie scheint Funktionalität gewisse konzeptuelle Probleme aufzuwerfen, vielleicht, weil der Begriff selbst eines Organs verschwand, als biologische Beziehungen in biochemischen Begriffen angegeben wurden; aber der Anschein trügt, bestimmte Funktionen bleiben bestehen, selbst in der Abwesenheit eines Organs oder organischen Systems. Komplexität ist also ein unerläßliches, wesentliches Konzept. Selbst unter einzelligen Organismen sind die Mechanismen, die an der Teilung und Verschmelzung von Chromosomen während der Mitose und Meiose beteiligt sind, Prozesse von unglaublicher Komplexität und Feinheit. Organismen präsentieren sich uns als ein komplexes Ensemble funktionaler Verknüpfungen. Wenn jemand ihre Evolution erklären will, dann muß er zur selben Zeit ihre Funktonalität und ihre Komplexität erklären. F: Was ist es, das funktionale Komplexität so schwer verständlich macht? S: Die Evolution lebendiger Kreaturen scheint eine essentielle Zutat zu verlangen, eine spezifische Form von Organisation. Was immer es auch ist, es liegt jenseits von allem, das unser gegenwärtiges Wissen auf dem Gebiet der Physik oder Chemie anzudeuten scheint; es ist eine Eigenschaft, auf die formale Logik absolut kein Licht zu werfen scheint. Ob Gradualisten oder Saltationisten, Darwinianer haben eine zu simple Konzeption von Biologie, eher wie ein Schlosser, der gegen alle Wahrscheinlichkeit davon überzeugt ist, daß seine handvoll Schlüssel jede Tür öffnen wird. Zum Beispiel neigen Darwinianer dazu, zu denken, Gene seien die Ausdrücke einer einfachen Anweisung: mach dies, erledige jenes, laß diese Seitenkette fallen. Die Arbeit von Walter Gehring über die regulativen Gene, welche die Entwicklung des Insektenauges kontrollieren, reflektiert diese Konzeption. Die relevanten Gene mögen gut auf diese Weise funktionieren, aber die Geschichte ist auf dieser Ebene sicherlich unvollständig und die Darwinsche Theorie ist nicht geeignet dazu, die fehlenden Stücke einzupassen. F: Sie behaupten, daß Biologen von einem Gen als einer Anweisung denken. Können Sie das eingehender erklären? S: Schematisch betrachtet, ist ein Gen wie eine Informationseinheit. Es hat einfache binäre Eigenschaften. Wenn aktiv, ist es eine elementare informationstheoretische Einheit, die Kaskade genetischer Vorschriften gleichen der Kaskade, die bei der Baubeschreibung eines Rezeptes beteiligt ist. Lassen Sie uns zu dem Beispiel des Auges zurück kehren. Darwinisten stellen sich vor, daß es was benötigt? Eintausend oder zweitausend Gene, um ein Auge aufzubauen, so daß die Baubeschreibung also ein- oder zweitausend Informationseinheiten benötigt? Das ist absurd! Nehmen wir an, eine europäische Firma schlägt vor, ein vollkommen neues Haushaltsgerät in einer südostasiatischen Fabrik herzustellen. Und nehmen wir weiter an, daß aus wirtschaftlichen Gründen diese Firma der Fabrik keinerlei Einzelheiten über die Funktionen des neuen Gerätes mitteilen möchte – wie es arbeitet, welchem Zweck es dienen soll. Mit nur ein paar Tausend Bits von Information, wird die Fabrik nicht sehr weit und nicht sehr schnell fortfahren können. Ein paar wenige Tausend Bit von Information ergeben letzten Endes nur einen einzigen Textabsatz. Das in Frage stehende Gerät ist notwendigerweise in hohem Maß einfacher als das Auge; mit der Herstellung des Geräts beauftragt, wird die Fabrik aber noch die Wertigkeit der Arbeitsgänge kennen müssen, zu denen sie sich verpflichtet hat, indem sie ihre Maschinen mietete. Das kann nur dadurch erreicht werden, indem sie schon einige Ahnung von der Natur des Objekts haben, bevor sie es unternehmen, es herzustellen. Ein beträchtlicher Wissensrumpf, der beiden gemeinsam zugänglich sein muß, der europäischen Firma und der Fabrik, ist nötig, bevor irgendwelche Herstellungsvorschriften ausgeführt werden können. F: Sie würden also vorbringen, daß das Genom nicht die benötigten Informationen zur Exklärung von Organismen enthält? S: Nicht gemäß des Wissens von Genomen, das wir jetzt besitzen. Die biologischen Eigenschaften, die von Biologen aufgerufen werden, sind in dieser Hinsicht ganz unzureichend; während Biologen verstehen mögen, daß ein Gen die Produktion eines bestimmten Proteins auslöst, erlaubt es dieses Wissen – diese Art von Wissen – ihnen nicht, zu verstehen, wie ein oder zweitausend Gene ausreichen, um den Verlauf embryonaler Entwicklung zu steuern. F: Man wird Sie des Preformationismus anklagen . . . S: Und wegen vieler anderer Verbrechen. Meine Position ist nichtsdestoweniger eine strikt rationale. Ich habe ein Problem formuliert, das mir entscheidend erscheint: wie kommt es, daß die Stoffe des Lebens mit so wenig elementaren Vorschriften Objekte produzieren können, die so unglaublich kompliziert und leistungsfähig sind? Diese Eigenschaft, mit denen sie ausgestattet sind – was nur ist denn ihre Natur? Nichts innerhalb unseres momentanen Wissens von Physik und Chemie erlaubt uns, es intellektuell zu erfassen. Wenn jemand vom evolutionistischen Standpunkt ausgeht, muß man zugeben, daß in der einen oder anderen Weise, die frühesten Fische die Fähigkeit in sich bargen - und auch die nötige neuronale Verdrahtung dazu -, Organe hervor zu bringen, die sie nicht besaßen oder selbst benötigten, die aber der alltägliche Besitz ihrer Nachfolger wären, als sie das Wasser verließen und auf dem Festland oder in der Luft lebten. F: Sie behaupten, daß der Darwinismus tatsächlich nicht viel erklärt. S: Es scheint mir, daß die Einheit von Zufallsmutation und Auslese einen gewissen beschreibenden Wert hat; in keinem Fall gilt die Beschreibung als eine Erklärung. Der Darwinismus bezieht ökologische Daten auf die relativ große Menge von Arten und Umwelten. In jedem Fall ist der beschreibende Wert Darwinscher Modelle ziemlich begrenzt. Nebenbei gesagt, wie die Saltationisten angedeutet haben, erscheint die Gradualistische These im Licht des Wachstums paläontologischen Wissens als vollkommen wahnsinnig. Die Wunder des Saltationismus, auf der anderen Seite, können das Rätsel, das ich beschrieben habe, auch nicht lösen. F: Lassen Sie uns zur natürlichen Auslese zurück kehren. Ist es nicht so, daß diese Idee, trotz allem, einen gewissen erklärenden Wert besitzt? S: Auf keinen Fall könnte jemand die allgemeine These leugnen, daß Stabilität eine notwendige Bedingung für die Existenz ist – das ist die wirkliche Doktrin der natürlichen Auslese. Die herausragende Anwendung dieses allgemeinen Prinzips kann man in Berthollet’s Gesetze der Elementarchemie finden. In der Wüste sind diejenigen Spezies, die rasch sterben, jene, die am meisten des Wassers bedürfen; dies erklärt jedoch noch lange nicht die Erscheinung derartiger Strukturen unter den Überlebenden, deren besondere Eigenschaft ihnen erlaubt, resistent gegen Dürre zu sein. Die These der natürlichen Auslese ist nicht sehr effizient. Mit Ausnahme bestimmter gekünstelter Fälle sind wir immer noch nicht imstande, vorherzusagen, ob diese oder jene Spezies dieser oder jener Abart begünstigt sein wird oder nicht bei Veränderungen der Umwelt. Was wir tun können ist, nach den Fakten die Effekte natürlicher Auslese aufzustellen – zum Beispiel, zu zeigen, daß bestimmte Vögel so veranlagt sind, daß sie diese besondere Schneckenart weniger oft fressen als andere Schneckenarten, vielleicht, weil ihre Schalen nicht genau so auffällig und deshalb weniger gut sichtbar sind. Das ist Ökologie: sehr interessant. Um es anders zu sagen, natürliche Auslese ist ein schwaches Beweisinstrument, weil die Naturereignisse, die von der natürlichen Auslese vorausgesetzt werden, offensichtlich sind und doch begründen sie nichts vom Gesichtspunkt der Theorie her. F: Ist nicht die Beziehung zwischen Zufallsmutationen und natürlicher Auslese das signifikante Charakteristikum des Darwinismus? S: Seit der Entdeckung des Programmierens müssen wir verstehen, daß ein Gen wie ein Wort ist, das aus dem Alphabet der DNA besteht; solche Wörter bilden den genomischen Text. Es ist dieses Wort, das die Zelle anweist, dieses oder jenes Protein zu bilden. Entweder ist ein gegebenes Protein strukturell oder ein Protein selbst arbeitet in Kombination mit anderen Signalen, die vom Genom geschickt werden, um wiederum noch ein anderes Protein herzustellen. Alle experimentellen Ergebnisse, die wir kennen, bewegen sich in diesem System. Das folgende Szenario wird dann zum Standard. Ein Gen erleidet eine Mutation, eine, welche die Reproduktion derjenigen Individuen erleichtern könnte, die es in sich tragen; mit der Zeit und in Hinsicht auf eine spezifische Umwelt, werden Mutanten statistisch bevorzugt und ersetzen Individuen, denen die erforderliche Mutation fehlt. Die Evolution könnte nicht eine Anhäufung solcher typographischer Irrtümer sein. Populationsgenetiker können die Geschwindigkeit studieren, mit der eine bevorzugte Mutation sich unter diesen Umständen ausbreitet. Sie tun dies mit großem Geschick, aber dies sind akademische Übungen, wenn auch nur deshalb, weil keine der Parameter, die sie benutzen, empirisch bestimmt werden können. Dazu kommen noch die Hindernisse, die ich schon genannt habe. Wir kennen die Anzahl der Gene in einem Organismus. Für die höheren Vertebrata gibt es um die Einhundert Tausend. Dies wissen wir ziemlich gut. Aber das erscheint gröblich unzueichend, um die unglaubliche Quantität von Informationen zu erklären, die man braucht, um Evolution innerhalb einer gegebenen Linie von Spezies zu bewerkstelligen. F: Was wäre ein konkretes Beispiel? S: Darwinisten sagen, daß Pferde, die einst Säugetiere in der Größe von Kaninchen waren, ihre Statur vergrößert haben, um schneller vor Beutetieren fliehen zu können. Innerhalb des gradualistischen Modells kann man ein spezifisches Charakteristikum isolieren – Vermehrung der Größe – und es als das Ergebnis einer Serie von typographischen Veränderungen betrachten. Der erklärende Effekt, den man so erreicht, ist rein rethorisch und gänzlich durch folgenden Kunstgriff suggeriert: indem man darauf besteht, daß für einen Pflanzenfresser wirklich nur die Geschwindigkeit zählt, die es erreichen kann, wenn es einem Beutetier gegenüber steht. Nun, das mag sogar teilweise wahr sein, aber es gibt keine biologischen Gründe dafür, die es uns erlauben, festzulegen, daß dies in der Tat die ausschlaggebende Betrachtungsweise ist. Letztlich könnte eine Vermehrung der Größe sehr wohl auch eine negative Auswirkung haben. Mir scheint, daß Darwinisten eine mechanistische Vision von Evolution konserviert haben, eine, die sie veranlaßt, eine rein lineare Abfolge von Ursache und Wirkung zu betrachten. Die Idee, daß Ursachen miteinander interagieren, ist heute Standard in der mathematischen Physik; es ist eine Tatsache, die Schwierigkeiten hatte, den Rückenpanzer biologischen Denkens zu durchdringen. Tatsächlich interagieren lokale Veränderungen in dramatischer Art und Weise in der Quasi-Totalität beobachtbarer Phänomene; letztendlich gibt es kaum eine Ausgabe von „La Recherche“, die nicht irgendeine Anspielung auf den Butterfly-Effekt beinhaltet. Die Informationstheorie ist genau das Gebiet, das unsere Intuitionen in Bezug auf diese Phänomene schärft. Eine typographische Veränderung in einem Computerprogramm verändert es nicht nur ein wenig. Sie vernichtet das Programm schlicht und einfach. Es ist das selbe wie mit einer Telefon-Nummer. Falls ich einen Korrespondenten anrufen will, dann ist es egal, ob ich eine, zwei, drei oder acht Ziffern falsch wähle. F: Sie folgen der Idee, daß biologische Mutationen echt und tatsächlich den Charakter typographischer Irrtümer haben? S: Ja, in dem Sinn, daß eine Bezugsgröße die Schablone für eine andere ist, ein Codon für ein weiteres, aber auf der Ebene biochemischer Aktivität paßt es nicht mehr, von Typographie zu sprechen. Es gibt eine vollständige Grammatik für die Bildung von Proteinen in drei Dimensionen, eine, die wir nur dürftig verstehen. Uns stehen keine physikalischen oder chemischen Gesetze zur Verfügung, die es uns erlauben würden, Zuordnungsabbildungen von typographischen Mutationen oder Modifikationen und biologisch effektiven Strukturen zu konstruieren. Um auf das Beispiel des Auges zurück zu kehren: einige wenige Tausend Gene werden zu seiner Herstellung benötigt, aber jedes für sich allein genommen deutet nichts an oder gibt nichts zu verstehen. Was bedeutsam ist, ist die Kombination ihrer Interaktionen. Diese kaskadierenden Interaktionen mit ihren Rückkopplungsschleifen beinhalten eine Organisation, deren Komplexität wir nicht zu analysieren verstehen. Es ist möglich, daß wir dazu in Zukunft in der Lage sein werden, aber es gibt keinerlei Zweifel darüber, daß wir es momentan nicht tun können. Gehring hat kürzlich ein Segment der DNA entdeckt, das sowohl bei der Entwicklung des Vertebratenauges beteiligt ist als auch die Entwicklung eines Auges im Flügel eines Schmetterlings anregen kann. Seine Arbeit beinhaltet eine Demonstration von etwas in höchstem Maß Erstaunlichem, aber keine Erklärung. F: Aber Dawkins, zum Beispiel, glaubt an die Möglichkeit eines kumulativen Prozesses. S: Dawkins glaubt an einen Effekt, den er „die kumulative Selektion vorteilhafter Mutationen“ nennt. Um seine These zu untermauern, nimmt er zu einer Metapher Zuflucht, die vom Mathematiker Emile Borel eingeführt wurde – jene, die von einem Affen redet, der zufällig auf einer Schreibmaschine herumhämmert, und am Ende ein literarisches Werk hervorbringt. Es ist eine Metapher, die, ich bedaure dies sagen zu müssen, von Francis Crick, dem Mit-Entdecker der Doppelhelix, mit Freuden aufgegriffen wurde. Dawkins ließ seinen Computer eine Serie von dreißig Briefen schreiben, die jeweils der Zahl von Buchstaben in einem Vers von Shakespeare entsprachen. Dann fuhr er fort, den Darwinistischen Mechanismus von Zufall und Auslese zu simulieren. Sein imaginärer Affe schrieb immer und immer wieder die selben Briefe, wobei der Computer in sukzessiver Folge denjenigen Satz auswählte, der dem Ziel-Vers am ähnlichsten war. Durch kumulative Selektion erreichte der Affe sein Ziel in vierzig oder sechzig Generationen. F: Aber Sie glauben nicht, daß ein Schreibmaschine schreibender Affe, auch wenn er sogar von einem Computer unterstützt würde . . . S: Diese Demonstration ist ein „trompe d’oeil“ – Augenwischerei – und, was viel wichtiger ist, Dawkins beschreibt nicht präzise, wie er dabei vorgeht. Zu Beginn der Übung scheinen per Zufallsgenerator generierte Sätze sich dem Ziel zu nähern; je enger die Annäherung, desto mehr beginnt der Vorgang zu verlangsamen. Es ist die Wirkung der Mutationen, die in die falsche Richtung wirken, welche die Dinge rückwärts zu ziehen beginnt. Tatsächlich zeigt eine simple Erörterung des Problems, daß das Fortschreiten komplett stecken bleibt, es sei denn, die numerischen Parameter werden wohl überlegt ausgesucht. F: Sie würden also sagen, daß das Modell der kumulativen Auslese, wie Dawkins es sich vorstellt, jenseits greifbarer biologischer Realität ist? S: Genau das. Dawkins’ Modell liegt vollständig neben dem dreifachen Problem von Komplexität, Funktionalität und ihrer Interaktion. F: Sie sind Mathematiker. Nehmen wir mal an, Sie formalisieren das Konzept der funktionalen Komplexität einmal, trotz Ihrer Vorbehalte . . . S: Ich würde mich auf eine Erkenntnis berufen, die au der wissenschaftlichen Gemeinschaft verbannt wurde, aber eine solche, die von jedermann sonst perfekt verstanden wird – die Erkenntnis eines Ziels. Als Computerwissenschaftler könnte ich das folgendermaßen zum Ausdruck bringen. Man konstruiert einen Raum, in welchem eine der Koordinaten eigentlich als Ariadnefaden dient, der die Bewegungsrichtung zum Ziel hin führt. Ist der Raum einmal konstruiert, entfaltet sich das System in mechanischer Weise zu seinem Ziel hin. Aber sehen Sie, die Konstruktion eines relevanten Raumes kann nicht vonstatten gehen, bis nicht eine vorbereitende Analyse durchgeführt worden wäre, eine solche, in der die Menge aller möglichen Bewegungsrichtungen veranschlagt worden wäre, dies zusammen mit einer Einschätzung ihrer durchschnittlichen Entfernung von dem spezifizierten Ziel. Die vorbereitende Analyse ist außerhalb der Reichweite empirischer Untersuchungen. Sie setzt voraus – das selbe Wort, das sich in der theoretischen Biologie zu wiederholen scheint – daß der Biologe (oder der Computerwissenschaftler) die Gesamtheit der Situation, die Eigenschaften des Ensembles der Bewegungsrichtungen, kennt. In Begriffe mathematischer Logik gefaßt, heißt das, daß die Natur dieses Raums vollständig enigmatisch (verschlüsselt) ist. Nichtsdestoweniger ist es wichtig, daran zu erinnern, daß das Leben selbst die konzeptualen Probleme, denen wir gegenüber stehen, vollkommen gelöst hat; die Systeme, die in den lebendigen Kreaturen eingebettet sind, sind vollständig erfolgreich in der Erreichung ihrer Ziele. Der Kunstgriff, der in Dawkins etwas blödem Beispiel involviert ist, setzt sich fort auf dem Wege der betrügerischen Einführung eines relevanten Raumes. Sein Computerprogramm rechnet von einem zufälligen Satz zu einem Ziel hin, eine Rechnung, der nichts in der biologischen Realität entspricht. Die Funktion, die er anwendet, schmeichelt jedoch der Imagination, weil sie jene Eigenschaft anscheinender Simplizität besitzt, die weltfremde Zustimmung hervor ruft. In der biologischen Realität hat der Raum selbst der einfachsten Funktion eine Komplexität, die dem Verständnis trotzt, und zwar jeder und aller Berechnung trotzt. F: Selbst wenn sie Darwin widersprechen, sind die Saltationisten sehr viel gemäßigter: sie geben nicht vor, den Schlüssel zu besitzen, der es ihnen erlauben würde, die Evolution zu erklären . . . S: Bevor wir jedoch die Saltationisten erörtern, muß ich ein Wort über den japanischen Biologen Mooto Kimura sagen. Er hat gezeigt, daß die Mehrheit der Mutationen neutral sind, ohne irgendeinen selektiven Effekt. Für die Darwinianer, die die zentrale Darwinsche These hoch halten, ist das peinlich . . . Die Sichtweise der Saltationisten, neu belebt von Stephen Jay Gould, repräsentiert letztlich eine Idee, die auf Richard Goldschmidt zurück geht. Im Jahre 1940 herum postulierte er die Existenz sehr heftiger, starker Mutationen, zweifellos Hunderte von Genen einschließend, die sehr rasch Statt fanden, in weniger als Eintausend Generationen, und dadurch unter dem Schwellenwert des Rasters der Paläontologie blieben. Man kann sich nicht genug wundern, daß Gould sich nicht betroffen zeigt und deshalb auch nicht dafür sorgt, die Einheit von Zufallsmutationen und Auslese zu bewahren. Die Saltationisten verheddern sich in zwei Arten von Kritik. Auf der einen Seite ist die Funktionalität ihrer voraus gesetzten Makromutationen unerklärbar im Rahmen der molekularen Biologie. Auf der anderen Seite ignoriert Gould schweigend die Hauptrichtungen der Biologie, wie z. B. die zunehmende Komplexität des Nervensystems. Er glaubt, daß der Erfolg der neuen, differenzierteren Spezies, solche wie die Säugetiere, ein zufälliges Phänomen ist. Er ist nicht in der Lage, eine Beschreibung des essentiellen Bewegungsablaufs der Evolution anzubieten, oder wenigstens eine Beschreibung ihrer Hauptbewegungsrichtungen. Die Saltationisten sind dadurch darauf beschränkt, zwei Arten von Wundern aufzurufen: Makromutationen und die Hauptbewegungsrichtungen der Evolution. F: In welchem Sinn gebrauchen Sie das Wort „Wunder“? S: Ein Wunder ist ein Ereignis, das einem Darwinianer als unmöglich erscheinen sollte in Anbetracht seiner ultra-kosmologischen Unwahrscheinlichkeit innerhalb des Rahmens seiner eigenen Theorie. Da wir gerade von Makromutationen sprechen, lassen Sie mich bemerken, daß es, um einen richtigen Elefanten hervor zu bringen, nicht genügen wird, ihn plötzlich mit einem voll ausgewachsenen Rumpf auszustatten. Beim Einrichten des Rumpfs muß das Cerebellum – ein anders geartetes aber komplementäres System – umgeformt werden, um einen Raum für das Ensemble von Verdrahtung zu schaffen, das der Elefant benötigen wird, um seinen Rumpf benutzen zu können. Diese Makromutationen müssen von einem System von Genen bei der embryonalen Genese koordiniert werden. Falls man die Geschichte der Evolution in Betracht zieht, müssen wir Tausende von Wundern postulieren; tatsächlich Wunder ohne Ende. Die Saltationisten sind nicht mehr als die Gradualisten imstande, eine Beschreibung jener Wunder zu liefern. Die zweite Kategorie von Wundern sind direktional und geben Anweisung für die großen evolutionären Fortschritte und Trends – die Ausarbeitung des Nervensystems natürlich, aber ebenso die Verinnerlichung der reproduktiven Prozesse und das äußerliche Erscheinungsbild der Knochen, das Auftreten von Ohren, die Bereicherung diverser funktionaler Beziehungen und so weiter. Jedes einzelne ist eine Serie von Wundern, deren Anhäufung den Effekt hat, die Komplexität und Effizienz diverser Organismen zu steigern. Von dieser Sichtweise aus beinhaltet die Idee der „bricolage“ (Bastelarbeit, Werken), die von Francois Jacob eingeführt wurde, eine interessante Redewendung, aber eine, die das völlige Fehlen von Erklärung verschleiert. F: Das Auftreten des Menschen – ist das ein Wunder in Ihrem Sinn? S: Natürlich. Und hier hat es den Anschein, daß da Stimmen unter den zeitgenössischen Biologen sind – ich meine Stimmen außer meiner eigenen -, die Zweifel auf das Darwinsche Paradigma werfen könnten, das die Diskussion während der letzten zwanzig Jahre dominiert hat. Beide, Gradualisten und Saltationisten, sind vollkommen unfähig, eine überzeugende Erklärung des quasi-simultanen Erscheinens einer Reihe biologischer Systeme zu geben, die den Menschen von den höheren Primaten unterscheiden: ihr Bipedalismus, mit der begleitenden Veränderung der Pelvis (Beckenhöhle), und ohne Zweifel des Cerebellums (Kleinhirn), eine viel geschicktere Hand mit Fingerabdrücken, die einen besonders feinen taktilen Sinn übertragen; die Modifikationen des Pharynx, das Phonation erlaubt; die Modifikationen des Zentralnervensystems, besonders auf der Ebene der Temporalen Lappen, welche die spezifische Erkennung von Sprache erlaubt. Von der embryonalen Genese aus betrachtet, sind diese anatomischen Systeme vollständig verschieden von einander. Jede Modifikation erzeugt eine Gabe, ein Vermächtnis von einer Primatenfamilie an ihre Abkömmlinge. Es ist überraschend, daß diese Gaben sich simultan entwickelt haben sollen. Einige Biologen sprechen von einer Prädisposition (Neigung) der Gene. Kann irgendwer tatsächlich diese Prädisposition entdecken, voraus gesetzt, daß sie tatsächlich existiert? War sie auch in den ersten Fischen vorhanden? Die Realität ist, daß wir einem totalen konzeptualen Bankrott gegenüber stehen. F: Sie erwähnten vorhin die Santa Fé Schule in unserer Diskussion. Ist die Anrufung solcher Ideen wie Chaos . . . S: Ich hätte auf eine Aufeinanderfolge hoch kompetenter Leute anspielen sollen, die allerlei poetische, aber hohle Ausdrucksformen entdeckt haben. Ich beziehe mich hier auf die lärmende Menge, die unter der Rubrik Kybernetik versammelt sind; und darüber hinaus, da liegen die dissipativen Strukturen von Prigogine, oder die Systeme von Varela, oder, um in die Gegenwart zu gehen, Stuart Kauffmanns „Edge of Chaos“ (Kante, Ecke des Chaos) – eine organisierte Form von Nichtigkeit, die bestimmt bald ihren Weg nach Frankreich finden wird. Die Santa Fé Schule nimmt Komplexität als Bezug zu absolut allem. Sie ziehen ihre repräsentativen Beispiele aus bestimmten chemischen Reaktionen, aus dem Muster der Meeresküste, aus atmosphärischen Turbulenzen oder aus der Struktur einer Kette von Bergen. Die Komplexität dieser Strukturen ist sicherlich beträchtlich, aber im Vergleich mit der Welt des Lebendigen zeigen sie in jedem Fall eine verarmte Form von Organisation, eine, die strikt nicht-funktional ist. Kein Algorithmus erlaubt uns, die Komplexität lebendiger Kreaturen zu verstehen, und dies trotz dieser Beispiele, die ihre ursprüngliche Plausibilität der Vermutung verdanken, daß die physikalisch-chemische Welt funktionale Eigenschaften zeigt, die sie in Wirklichkeit gar nicht besitzen. F: Soll man Ihre Position als Darstellung von Resignation verstehen, als Aufruf zu größerer Einfachheit und Bescheidenheit, oder als etwas gänzlich anderes? S: Ironisch redend könnte ich sagen, daß alles, was wir zur Zeit hören, die große anthropische Hymne ist, in der sogar allerhand mathematisch fortgeschrittene Gelehrte den Takt halten, während die große Hymne durch das Klopfen ihrer Füße angestimmt wird. Der Rest von uns sollte natürlich eine gewisse Aussetzung des Urteils praktizieren. Copyright © 1996 Marcel-Paul Schützenberger. All rights reserved. International Copyright secured. Übersetzt von Roland R. Noetzelmann 2006 aus dem Amerikanischen Ich danke ARN (Access Research Network) für ihre freundliche Genehmigung. ARN – findet man hier: http://www.arn.org/ Das Original-Dokument findet man hier: http://www.arn.org/docs/odesign/od172/schutz172.htm | |||||
